Auf dieser Seite können Sie das Diskussionspapier zu der Einreichung für das Journal für Medienlinguistik im PDF-Format herunterladen. Das Blogstract fasst die Einreichung allgemein verständlich zusammen. Sie können das Diskussionspapier und das Blogstract unter diesem Beitrag kommentieren. Bitte benutzen Sie hierfür Ihren Klarnamen. Bei Detailanmerkungen zum Diskussionspapier beziehen Sie sich bitte auf die Zeilennummerierung des PDFs.
Blogstract zu
Parasoziale Bindung durch Erfahrungsaustausch in Online-Communitys. Explorative Fallanalyse eines ‚Realtalks‘ auf YouTube und der reaktiven Kommentare
von Maria Fritzsche
Soziale Netzwerke, Streaming-Plattformen und Videoportale spielen eine zunehmend zentrale Rolle bei der Freizeitgestaltung vieler Menschen (Uttarapong et al. 2022: 5:2). Diese digitalen Räume werden als „third places“ (Hamilton et al. 2014: 1315) charakterisiert. In ihnen treten Personen außerhalb ihres familiär-freundschaftlichen Umfeldes und des Arbeitsplatzes mit anderen Menschen in Kontakt, suchen Zerstreuung und Unterhaltung, sie lernen fremde Ansichten kennen und bilden eigene. Als weitere Motivation wird der Wunsch beschrieben, durch den Austausch über geteilte Erfahrungen und Interessen sowie durch gemeinsame Handlungen (teils sporadische) Interaktionsgemeinschaften zu bilden (Antos 2019: 67). Dabei sind die Plattformen von zwei kommunikativen Rollen geprägt: den Content-Creator*innen und den Community-Mitgliedern. Um beruflich erfolgreich zu sein, müssen erstere ihre Online-Persona attraktiv und authentisch gestalten sowie soziale und emotionale Bedürfnisse ihrer Zielgruppe befriedigen (Hartmann 2017: 50).
Der Beitrag untersucht sprachlich-kommunikative sowie funktionale Aspekte dieser parasozialen Beziehung anhand eines Fallbeispiels. Als Untersuchungsgegenstand dient ein asynchroner und modalitätsübergreifender Dialog auf YouTube.
In einem über 37 000-mal aufgerufenen Video erzählt der deutschsprachige Content-Creator mittlerer Reichweite Donnie O’Sullivan den interessierten Zuhörer*innen von seinem aktuellen kognitiv-emotionalen Zustand, der ihm Sorge bereitet. Das Kommunikat ist als ‚Realtalk‘ markiert, also als aufrichtige Auseinandersetzung mit einem persönlich relevanten Thema und grenzt sich damit von seinem üblichen humoristischen Content ab. Eine kombinierte Analyse des emotionsausdrückenden Wortschatzes, der Informationsstruktur sowie der Kommunikation durch körperlich und mündlich vermittelte Merkmale zeigt auf, warum die geteilten Empfindungen des Sprechers potenziell authentisch wirken: O’Sullivan scheint im Moment der Videoaufnahme aktiv zu grübeln und während der Beschreibung seines Zustands um Deutung zu ringen.
In 533 reaktiven Kommentaren kommen einige der Community-Mitglieder dem Wunsch des Content-Creators nach Feedback nach. Diese schriftsprachlichen Beiträge werden in einer quantitativ informierten qualitativen Analyse untersucht. Dabei werden intertextuelle Bezugnahmen, Sprechakte und Diskurserweiterungen näher betrachtet. Die Kommentator*innen versichern dem Content-Creator Verständnis und Identifikation, loben seine Ehrlichkeit, erzählen von ähnlichen Erfahrungen und schlagen mögliche Erklärungen und Lösungen für sein psychisches Problem vor. Obwohl sowohl konsensuale als auch kontroverse Interpretationen auftreten, zeichnet sich nur in Ausnahmen eine Emanzipation des Diskurses ab.
Die explorative Fallanalyse zeigt, wie Content-Creator*innen die parasoziale Bindung zu ihrer Community durch authentische Thematisierung persönlicher Erfahrungen festigen und erweitern können. Gleichzeitig vermögen sie so ihre Netzgemeinschaft zu psychischer Entlastung, Selbstreflexion, narrativer Selbstdarstellung und Deutung geteilter Erfahrungen anzuregen. Diese emotional-kognitiven Prozesse könnten auch diejenigen betreffen, die sich passiv rezipierend auf die sprachlichen Handlungen in Video und Kommentarspalte einlassen. Eine partizipatorisch-egalitäre Interaktion scheint sich in diesem Medienformat hingegen nicht zu etablieren. Es bleibt vielmehr bei einem Dialog zwischen Content-Creator, der sich an seine Community richtet, und der*die den Content-Creator adressierende Kommentator*in über das von ersterem in den Diskurs eingebrachte Thema. Eine systematische Untersuchung der eruierten sprachlichen Aspekte parasozialer Beziehungen anhand einer breiter angelegten Korpusstudie scheint ein vielversprechendes Desiderat – auch, um ihre mögliche Adaption und Perversion in monetarisierten oder extremisierten digitalen Kontexten besser zu verstehen.
Literatur
Antos, Gerd (2019): Medien, Wahrnehmung, Öffentlichkeit. Wahrnehmungs-Gemeinschaften und deren Interaktion als Gegenstand der Medienlinguistik. In: Hauser, Stefan/Opilowski, Roman/Wyss, Eva L. (Hg.): Alternative Öffentlichkeiten: Soziale Medien zwischen Partizipation, Sharing und Vergemeinschaftung. Bielefeld: transcript Verlag (Edition Medienwissenschaft, 35), 53–80.
Hamilton, William A./Garretson, Oliver/Kerne, Andruid (2014): Streaming on Twitch: Fostering Participatory Communities of Play within Live Mixed Media. Toronto Ontario Canada: ACM, 1315–1324.
Hartmann, Tilo (2017): Parasoziale Interaktion und Beziehungen: 2. Auflage. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft (Konzepte. Ansätze der Medien- und Kommunikationswissenschaft, 3).
Uttarapong, Jirassaya/LaMastra, Nina/Gandhi, Reesha/Lee, Yu-hao/Yuan, Chien Wen (Tina)/Wohn, Donghee Yvette (2022): Twitch Users’ Motivations and Practices During Community Mental Health Discussions. In: Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 6, Article No. 5.
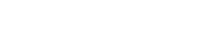
Ein sehr interessanter Aufsatz. In der heutigen Zeit scheint die Thematik Mental Health und Parasozialität ja immer relevanter, d.h. wichtiger zu werden. Dahingehend bietet die Autorin einen schönen beispielhaften Einblick aus linguistischer Perspektive, der auch für Fachfremde gut nachzuvollziehen bleibt. Abgesehen vom etwas unaufgeräumt wirkenden Layout (warum nicht Blocksatz?) nichts zu beanstanden!
Gutachten zu
Maria Fritzsche
Parasoziale Bindungen durch Erfahrungsaustausch in Online-Communities. Explorative Fallanalyse eines ‚Realtalks‘ auf YouTube und der reaktiven Kommentare
von Birte Bös
Empfehlung: Annahme mit Überarbeitungen
Die vorliegende Studie bietet eine facettenreiche, reichhaltige Analyse eines YouTube-Videos und der dazugehörigen reaktiven Kommentare, die ich mit großem Interesse gelesen habe. Anschaulich arbeitet die Vfn. zum einen heraus, wie der ausgewählte Content-Creator (CC) mittels verschiedener semiotischer Ressourcen ein hohes Maß an Authentizität und Relatability erzeugt und zeigt andererseits, dass zwar die Partizipation in der Kommentarspalte hoch, die Interaktion zwischen den Kommentierenden selbst jedoch eher gering ist. Dennoch attestiert sie dieser Form der Auseinandersetzung mit psychischen Erfahrungen in Online-Communities eine unterstützende Wirkung, die die emotionale Resilienz der Beteiligten fördern kann.
Verortung der Studie
Damit steht die vorliegende Fallstudie im Kontext der bereits seit über einem Jahrzehnt bestehenden Forschung zu Partizipations- und Interaktionsmustern in sozialen Medien (beispielhaft seien hier frühe Arbeiten wie Dynel & Chovanec 2015 und Landert 2017 sowie Garcés-Conejos Blitvich & Georgakopoulou 2024 genannt), in der sich die Studie aus meiner Sicht stärker verankern sollte. Gleiches gilt für den Aspekt der Multimodalität, wobei neben Grundlagen der sozialen Semiotik (etwa Kress & van Leeuwen 1996 [2021], van Leeuwen 2021) mittlerweile zahlreiche Einzelstudien zu Multimodalität in sozialen Medien vorliegen (ganz aktuell z.B. Vásquez & Chovanec 2025). Wichtig wäre zudem m.E. eine umfassendere Auseinandersetzung mit den Schlüsselkonzepten Authentizität und (Gruppen)Identität, insbesondere im Hinblick auf deren theoretische Fundierung und konkrete Operationalisierung in der Auswahl der Analyseschwerpunkte (siehe auch Forschungsfragen).
Datenauswahl
Die Fallstudie beruht auf einem zweiteiligen Datensatz: Die Vfn. hat ein ca. 14-minütiges YouTube Video, einen sogenannten ‚Realtalk‘ des CC Donnie O’Sullivan, ausgewählt. Dieser stark selektive Fokus rechtfertigt sich durch die Komplexität der geplanten multimodalen Analyse. Ergänzt wird der Datensatz durch die 561 reaktiven Kommentare zum Video. Die Datenauswahl ist transparent dargestellt und die Daten sind adäquat aufbereitet (z.B. Transkription nach GAT2, Frame-Comic für nonverbale Analyse).
Struktur
Die Struktur des Beitrags ist zwar in sich grundsätzlich schlüssig, allerdings würde ich zur besseren Leserorientierung folgende Empfehlung geben:
Gegenwärtig gliedert sich der Beitrag in vier Kapitel (1. Forschungsinteresse, 2. Explorative Fallanalyse, 3. Diskussion, 4. Fazit und Ausblick). Da der inhaltliche Fokus des Beitrags auf der explorativen Fallanalyse ohnehin gesetzt ist, könnte diese Gliederungsebene im Punkt 2 zugunsten einer besseren Sichtbarkeit der Hauptbestandteile der Analyse aufgegeben und entsprechend ersetzt werden, z.B.: 2. Untersuchungsgegenstand; 3. Videoanalyse, 4. Analyse der reaktiven Kommentare (gefolgt von 5. Diskussion, 6. Fazit und Ausblick).
Als hilfreich empfände ich eingangs außerdem eine Übersicht über die genaue Zusammensetzung des Datensatzes und die Bündelung der Forschungsfragen (z.B. in Kapitel 2 (neu)). Derzeit sind jeweils drei spezifische Forschungsfragen am Beginn der Videoanalyse (2.2) und der Analyse der reaktiven Kommentare (2.3) untergebracht (zur inhaltlichen Gestaltung siehe auch untenstehender Kommentar). Ergänzend zu den video- und kommentarspezifischen Forschungsfragen erschiene auch die explizite Formulierung einer übergeordneten Fragestellung sinnvoll.
Ethische Aspekte
Ethische Fragen werden im vorgelegten Beitrag bislang nicht adressiert, sollten jedoch unbedingt reflektiert werden. Auch wenn die analysierten Daten (YouTube-Video und Kommentare) öffentlich zugänglich sind, bedeutet dies nicht, dass sie ohne weitere ethische Abwägung wissenschaftlich ausgewertet werden sollten. Dies erscheint umso wichtiger, da es sich beim Realtalk um sensible Inhalte handelt, die kognitiv-emotionale Zustände sowie psychische Schwierigkeiten des CC und der Kommentierenden betreffen. Eine kurze Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der informierten Zustimmung, Fragen des Datenschutzes und der stattfindenden Rekontextualisierung personenbezogener Aussagen wären daher wünschenswert. In der Forschung zu Social-Media-Daten wird diese Problematik seit längerem diskutiert (siehe z.B. Handbuchartikel wie Page et al 2022, Tagg & Spilioti 2022), und eine Verortung der eigenen Analyse in diesen ethischen Diskursen würde die Studie deutlich stärken.
Analyse des Videos
Die Analyse des Videos wird von folgenden Forschungsfragen (Z. 164-171) geleitet:
Aus meiner Sicht könnten insbesondere die ersten beiden Forschungsfragen noch präzisiert werden, um die Operationalisierung der Analyse bereits von Anfang an klarer aufzuzeigen. Tatsächlich erscheint in ihrer derzeitigen Formulierung die erste Forschungsfrage sehr breit und wird dann in der zweiten Forschungsfrage etwas heruntergebrochen, wobei die Liste sich auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen bewegt („Sprache“ vs. „Informationsstruktur und konversationelle Merkmale“). Vielleicht könnte die Vfn. bereits hier die Bestandteile ihrer Untersuchung des Videos (Wortschatzanalyse, thematisch-funktionale Sequenzanalyse sowie Gesprächsanalyse des narrativen Hauptteils inklusive nonverbaler und verbaler Anteile) mit Bezug auf das Schlüsselkonzept der Authentizität aufzeigen. Die dritte Forschungsfrage wird gut im Zwischenfazit aufgenommen.
Die Wortschatzanalyse beginnt mit einer Zusammenstellung selbstreferentieller Emotionsbeschreibungen in Tabelle 1. Dabei suggerieren die dort isolierten linguistischen Einheiten eine klare Opposition von Wunsch- und Istzustand des CC („was er fühlen will“ – „was er fühlt“). Allerdings erscheint die Einordnung unter Einbeziehung des Kotextes nicht immer so eindeutig. So wird z.B. genießen als „was er fühlen will“ kategorisiert, tatsächlich ist das Verb aber eingebettet in eine Zustandsbeschreibung der „letzten vier Tage“: „ich hatte einfach so wahnsinnig Probleme, einfach mal zu genießen“ (03:50) – hier wird m.E. ein Ist-Zustand dargestellt, der einen Wunschzustand eher impliziert. In der anschließenden Diskussion klingt zudem bereits das Ringen des CC um adäquate Beschreibung seines emotional-kognitiven Zustands an, das tatsächlich an vielen Stellen im Video zu beobachten ist. So stellt sich beispielsweise, im Kotext betrachtet, echt Angst – keine Angst (Z. 237-238) nicht als Widerspruch, sondern als Präzisionsversuch heraus: „nicht Angst, einfach keine gute Laune“ (09:38).
Zudem bleibt unklar, ob die Liste in Tabelle 1 Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Einerseits fehlen weitere Emotionsbeschreibungen, die in die aufgezeigte Opposition von Wunsch- und Istzustand passen (z.B. „schlechtes Gewissen“, 12: 43). Andererseits äußert der CC aber auch positive Zustände („mach ich mich nicht allzu verrückt“, 10:13), sowohl in der Erfahrung mit der selbst auferlegten Social Media Abstinenz („es hat erstmal gutgetan“, 06:50), als auch mit Blick auf die bevorstehende Rückreise („ich freue mich“, 13:06), insbesondere aber in Bezug auf die wohltuende Wirkung der Realtalk-Aktivität selbst („durch‘s Reden geht‘s mir besser“, 08:10; „es tut gut, Sachen auszusprechen“, 08:17; „hat mir gerade sehr gut getan“, 12: 48). Damit erscheint die Haltung des CC insgesamt deutlich ambivalenter, als die Übersicht in Tabelle 1 suggeriert, wie aber die Vfn. selbst in der anschließenden kurzen Diskussion schon andeutet und in der weiteren Analyse sehr gelungen herauskristallisiert.
Sehr gut ist die erratische Informationsstruktur des Videos in Abb. 3 visualisiert und wird in der anschließenden Darstellung von der Vfn. genauer charakterisiert. In der Gesprächsanalyse des Hauptteils widmet sich die Vfn. zunächst nonverbalen Aspekten, die mittels sechs Standbildern illustriert werden. Die Darstellung wechselt zwischen beschreibend und interpretierend, was nachvollziehbar ist, allerdings methodisch reflektiert werden sollte. Auch die Analyse eines kurzen Auszugs aus dem Transkript ist reich an exemplarischen Beobachtungen zu verbalen und paralinguistischen Elementen.
Funktional deutet die Vfn. das Video, dem sie eine hohe Authentizität attestiert, in der Innenperspektive als „kathartisches Erlebnis“ (Z. 424) für den CC, „währenddessen er mit sich Natur, Intensität und Relevanz seines emotional-kognitiven Zustands aushandelt“ (Z. 425-426), und in der Außenperspektive als Appell zur Anteilnahme der User*innen.
Analyse der reaktiven Kommentare
Die Analyse der reaktiven Kommentare widmet sich den folgenden Forschungsfragen (Z. 466-470):
Die erste Forschungsfrage wird quantitativ mittels einer Keywordanalyse bearbeitet. Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage beruht auf einer quantitativ informierten qualitativen Analyse der Illokutionen sowie einer Detailanalyse des beliebtesten Kommentars. Auch hier rundet ein Zwischenfazit zur Funktion der Kommentarspalten für die User*innen die Untersuchung des zweiten Teils des Datensatzes ab.
In der quantitativen Auswertung der 561 Kommentare zeigt sich eine hohe Nutzeraktivität, allerdings wenig Interaktivität zwischen den Kommentatorinnen. Stattdessen richten sich die meisten Kommentare direkt an den CC, der jedoch seinerseits nur in sehr seltenen Ausnahmefällen reagiert. Die Analyse der 200 häufigsten Keywords arbeitet anschaulich vier zentrale Referenzbereiche der Kommentare heraus, die die wesentlichen Themen aus dem Video aufnehmen (Emotion/Kognition, Psychische Gesundheit, Zeit/Freizeit, Medienkonsum).
Die manuelle, computergestützte Kategorisierung der Illokutionen ermöglicht differenzierte Einblicke in die kommunikativen Praktiken, die das Sprachhandeln in dieser Online-Community prägen. Die Analyse des beliebtesten Einzelkommentars zeigt hingegen auf, wie durch eine inklusive Perspektive und thematische Erweiterung die Interaktivität zwischen den Kommentierenden angeregt wird.
Funktional, so stellt die Vfn. fest, machen Nutzer*innen also im Wesentlichen Gebrauch von der Möglichkeit zum respektvollen, unterstützenden virtuellen Zwiegespräch mit dem CC sowie zur Selbstreflexion und Selbstdarstellung. Trotz der fehlenden Interaktion zwischen den Teilnehmenden attestiert sie der Co-Präsenz in der virtuellen Community durch die geteilten Erfahrungen einen positiven Beitrag zur Stärkung emotionaler Resilienz.
Fazit
Der vorliegende Beitrag überzeugt insbesondere durch seine detailreiche, multiperspektivische Untersuchung eines exemplarischen Datensatzes aus den sozialen Medien (Video + reaktive Kommentare), könnte aber durch eine systematischere theoretisch-methodische Fundierung und Verknüpfung mit der bisherigen Forschung noch an Aussagekraft gewinnen.
Referenzen
Dynel, Marta; Jan Chovanec (Hrsg.). 2015. Participation in Public and Social Media Interactions. Amsterdam: Benjamins.
Garcés-Conejos Blitvich, Pilar; Alexandra Georgakopoulou (Hrsg.). 2024. Influencer Discourse. Affective Relations and Identities. Amsterdam: Benjamins.
Kress, Gunther; Theo van Leeuwen (1996 [2021]), Reading Images: The Grammar of Visual Design, 3. Aufl., London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Landert, Daniela. 2017. Participation as user involvement. In: Christian Hoffmann and Wolfram Bublitz (Hrsg.), Pragmatics of Social Media. Berlin/Boston: de Gruyter Mouton, 31–59.
Page, Ruth, David Barton, Johann W. Unger and Michele Zappavigna (Hrsg.). 2022. Researching Language and Social Media. A Student Guide. 2. Aufl., London/New York: Routledge, Ch. 4, 57-78.
Tagg, Caroline; Tereza Spilioti. 2022. Research ethics. In: Camilla Vásquez (Hrsg.), Research Methods for Digital Discourse Analysis, London: Bloomsbury, 91-113.
Vásquez, Camilla; Jan Chovanec (Hrsg.). 2025. Experiencing Digital Discourses: Multimodality, Engagement, Activism. Cham: Palgrave Macmillan.
Gutachten zu
Parasoziale Bindung durch Erfahrungsaustausch in Online-Communitys
von Jannis Androutsopoulos
Empfehlung: Annahme mit grundlegender Überarbeitung (major revisions)
Der Beitrag hinterlässt bei mir einen zwiespältigen Eindruck. Zunächst sind die korpus- und diskursanalytischen Analysefähigkeiten der Autorin nachdrücklich zu würdigen. Der Beitrag lässt ein sehr gutes Datenmanagement und analytisches Durchdringen der Daten auf lexikalischer und handlungspragmatischer Ebene erkennen. Auch digitale Kompetenzen sind vorhanden, obgleich sie stellenweise ergänzt werden könnten (etwa mit Blick auf YouTubeDataTools als standardmäßige Lösung für das Abgreifen von YT-Kommentaren). Die sehr gute redaktionelle Qualität, der präzise und zugleich einfühlsame Schreibstil machen einen vielversprechenden Eindruck.
Auf inhaltlicher Seite möchte ich hingegen Bedenken äußern. Hervorzuheben ist, dass die vorgelegte „explorative Fallanalyse“ m.E. nicht angemessen kontextualisiert wird. Sie wirkt auf mich doch eher wie eine methodisch-analytische „Fingerübung“, bei der unklar bleibt, wofür sie eigentlich steht. Es fehlen genauere Bestimmungen von Konzepten wie parasoziale Interaktion, Online-Community bzw. Netzgemeinschaft, Anschlusskommunikation. Diese werden entweder beiläufig referenziert oder ihr Verständnis wird implizit vorausgesetzt. Dadurch gelingt es dem Beitrag (noch) nicht, als Fallanalyse für einen theoretisch hergeleiteten Zusammenhang lesbar zu sein. Gleichzeitig ist der Beitrag im relevanten Forschungsfeld – YouTube-Kommunikation und Anschlusskommunikation – nicht ausreichend verortet. Es wird zwar gesagt, dass auf YouTube und anderen Plattformen zwei Diskursrollen (Postings und Kommentare) zentral sind, viel mehr dazu kommt jedoch nicht. Dabei gibt es zu beiden Aspekten inzwischen eine reichhaltige deutsche und internationale Forschung, die es hier zu rezipieren und aufzubereiten gälte, z.B. über Handbücher, Fachzeitschriften (Journal of Pragmatics; Discourse, Context & Media; teilweise auch ZfAL, nicht zuletzt JfML) sowie Bücher/Sammelbände über digitale Diskursanalyse und Anschlusskommunikation. Zum letztgenannten Thema sollten die deutschsprachigen Arbeiten von Katharina Christ, Marc Ziegele und der Band Bucher/Bou/Christ unbedingt aufbereitet werden, damit die vorgelegte Analyse in einen Forschungskontext eingebettet werden kann.
Die fachlichen Standards für empirische Zeitschriftenbeiträge sehen m.E. vor, dass all dies in einem einleitenden Abschnitt geleistet wird, um dadurch den Weg für die eigene Analyse einzuebnen. Dies findet hier nicht statt, zumindest nicht in einer publikationsfähigen Art und Weise. Zwar bewegt sich Abs. 1 „Forschungsinteresse“ ab S. 2, Zeile 31 in diese Richtung, dort werden jedoch nur einzelne Signale gesetzt, keine größeren Forschungszusammenhänge erläutert. Hier sollten Arbeiten zum Verhältnis Content Creator und Followerschaft auf YouTube einerseits, zu den Themen Anschlusskommunikation andererseits aufbereitet werden. Etwas mehr zu diesen Themen kommt in der Diskussion, aber auch dort fehlt wie gesagt die Aufbereitung passenden Fachwissens.
Zudem sollte die Autorin ihre Schwerpunkte priorisieren und sich entscheiden, was sie primär untersuchen möchte. Im Mittelpunkt steht aktuell das Zusammenspiel von Medienbeitrag und Anschlusskommunikation, es wird analytisch, trotz fehlender theoretischer Rahmung, sehr gut erfasst. Die Konstitution einer Online-Community wird hingegen nicht wirklich untersucht und ist m.E. bei dem gesetzten Fokus auf ein einzelnes Video nicht zu leisten, sondern würde wesentlich mehr Kontextanalyse benötigen.
Zusammenfassend: Die Autorin legt spannende Analysekompetenzen an den Tag. Allerdings fehlt dem Beitrag eine nachvollziehbare Forschungsfrage, und die Einbettung in den einschlägigen Forschungsstand zu den spezifischen Themen YouTube-Kommunikation und Kommentaranalyse bzw. Anschlusskommunikation ist leider schwach (die Bezugnahme auf korpus- und diskurslinguistische Literatur ist hingegen sehr gut). Persönlich sehe ich hier viel Potenzial, aber noch kein publikationsfähiges Resultat, und empfehle daher eine gründliche Überarbeitung.
Kleinere Einzelanmerkungen:
S. 7 – downsub.com greift keine Videos ab, die Formulierung klingt hier etwas irreführend.
S. 16, Fn 14 – Bitte darauf achten, dass beim Anklicken nicht gleich eine Zipdatei heruntergeladen wird.
Literatur
Bucher, Hans-Jürgen / Bettina Boy / Katharina Christ (2022) Audiovisuelle Wissenschafts-kommunikation auf YouTube: Eine Rezeptionsstudie zur Vermittlungsleistung von Wissenschaftsvideos. Wiesbaden: Springer VS.
Christ, Katharina (2021) Wissenschaftsvideos auf YouTube. Interaktionsanalysen zur Anschlusskommunikation. Gießen: Gießener Elektronische Bibliothek. http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2021/15083/
Georgakopoulou, Alexandra / Tereza Spilioti (Hgg. 2016). The Routledge handbook of language and digital communication. Abingdon: Routledge.
Ziegele, Marc (2016). Nutzerkommentare als Anschlusskommunikation. Theorie und qualitative Analyse des Diskussionswerts von Online-Nachrichten. Wiesbaden: Springer.